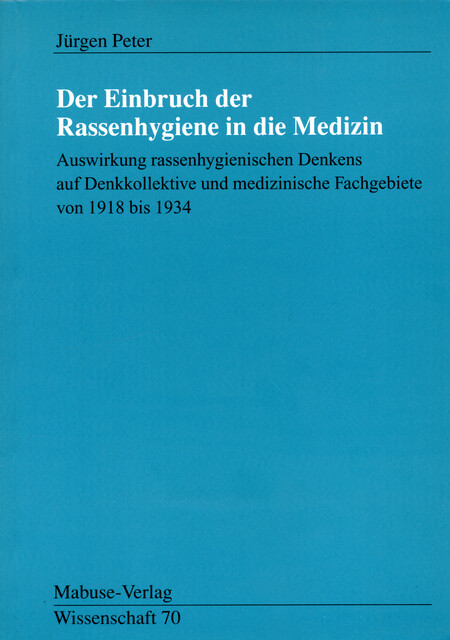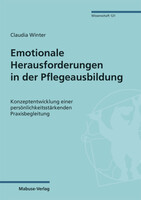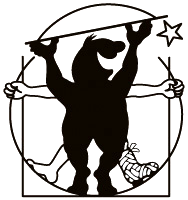
Der Einbruch der Rassenhygiene in die Medizin
Auswirkung rassehygienischen Denkens auf Denkkollektive und medizinische Fachgebiete von 1918 bis 1934
- Verlag: Mabuse
- Umfang: 240 Seiten
- Erscheinungsjahr: 2004
- Bestellnummer: 01133
- ISBN: 9783935964333
-
nur noch als Restauflage lieferbar
In dieser Studie werden Einbruch und Durchsetzung der Rassenhygiene in wichtigen klinischen Disziplinen vom Ende des Ersten Weltkrieges bis zur Etablierung der NS-Herrschaft untersucht. In einem weiteren Abschnitt wird die Psychiatrie als politisches Instrument der Gegenrevolution 1918/1919 dargestellt. Auch hier kann gezeigt werden, welche Rezeptionskarriere der Rassenhygiene im Gewande der Entartungsdebatte, in der psychiatrischen Medikalisierung und Diffamierung politisch Andersdenkender und schließlich auf dem Gebiet der Forensischen Psychiatrie beschieden war.
"Die große Stärke dieser Untersuchung liegt darin, dass es Peter gelungen ist, trotz der Unterschiedlichkeit der einzelnen wissenschaftlichen Felder darzustellen, mit welcher Zwangsläufigkeit sich ein auf populären Konzepten und vorwissenschaftlichen Präideen beruhender Denkstil in eine seriöse Wissenschaft verwandelte und in nahezu allen Gebieten der Medizin theoretische wie moralische Grundüberzeugungen prägte."
(Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 2/2005)
"Es wird aufgezeigt, welche Elemente dieses Denkens im Gewande einer 'Entartungsdebatte' in der psychiatrischen Medikalisierung, Diskreditierung und Diffamierung politisch Andersdenkender bis hin zur Forensischen Psychiatrie beschieden war. Jürgen Peter ist ein ausgewiesener Kenner dieses Stoffgebietes, (...) Das Buch, ein wichtiger Beitrag zum Verständnis rassenhygienischen Denkens und dessen Eingang in die Medizin."
(Hessisches Ärzteblatt, Heft 12, Dezember 2004, Dr. med. Siegmund Drexler)
"In dit zeer uitgebreid gedocumenteerde boek maakt Peter inzichtelijk hoe diep de wortels van de Rassenhygiene in de medische wetenschappen reikten en een weerspiegeling vormden van de tijdsgeest in de periode tussen de twee wereldoorlogen. Waartoe een dergelijk Paradigma nationaal-socialistische politici legitimering na 1933 verschafte, heeft de geschiedenis ons pijnlijk geleerd."
(Medische Anthropologie, 16 (2) 2004)
Jürgen Peter
Die praktische Pflegeausbildung stellt Auszubildende vor emotionale Herausforderungen, wenn sie – oft zum ersten Mal – mit Leid, Krankheit, Sterben und Tod sowie mit Gefühlen wie Verzweiflung, Angst und Trauer
...alles anzeigenkonfrontiert werden. Solche Erfahrungen prägen beruflich wie persönlich.In dieser qualitativen Studie entwickelt Claudia Winter ein persönlichkeitsstärkendes Praxisbegleitungskonzept, dessen Grundlage empirisch gewonnene Erkenntnisse zu emotionalen Herausforderungen von Auszubildenden sind.Die Untersuchung verdeutlicht den Einfluss emotionaler Herausforderungen während der praktischen Pflegeausbildung auf ihren Abschluss und zeigt, wie konkrete Lehr- und Lernarrangements psychischen Krankheitsbildern und Phänomenen wie Cool-Out, Burn-Out und Drop-Out in der Pflege vorbeugen könnten.
Wie Pflegende den gesetzlich verankerten, unauflösbaren Widerspruch zwischen pflegefachlichem Anspruch und der Sicherung der Arbeitsabläufe innerhalb ökonomischer Zwänge aushalten, untersucht Karin Kersting mit
...alles anzeigenihren wegweisenden „Coolout“-Studien: Pflegekräfte entwickeln Strategien der Kälte – sie lernen hinzunehmen, wogegen sie angehen müssten, weil es dem widerspricht, was sie verwirklichen wollen.Oliver Weinmann verknüpft die Theorie des „Coolout“ mit dem pflegedidaktischen „Modell der multidimensionalen Patientenorientierung“ (Wittneben) und erweitert dieses. Anhand eines Fallbeispiels zeigt er, wie die Versorgungsrealität, die dem pflegefachlichen Anspruch entgegensteht, systematisch in pflegedidaktische Konzepte eingearbeitet werden kann. Diese Zusammenführung trägt zur authentischeren Vermittlung von Unterrichtsthemen bei und fördert einen kritischen Bildungsprozess.
In der Bundesrepublik Deutschland wurden Arzneimittel an Heimkindern getestet, um sozial erwünschtes Verhalten oder Sedierung zu erreichen. In teils systematischen Versuchen wurden neben Neuroleptika etwa Präpa
...alles anzeigenrate gegen Bettnässen, zur Gewichtsreduktion oder Triebdämpfung eingesetzt. Sylvia Wagner recherchierte dazu in Prüfberichten, Dokumenten aus pharmazeutischen Unternehmen und Bewohnerakten einer Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung. Sie zeichnet ein bedrückendes, doch authentisches Bild dieser bisher kaum untersuchten Problematik – von Opfern und Tätern, ökonomischen und gesellschaftlichen Interessen und Gegebenheiten. Dieses Buch ist ein wichtiger Beitrag zur Medizingeschichte. Es wirft Licht auf ein verdrängtes Kapitel der deutschen Nachkriegszeit und trägt zur Aufarbeitung von Gewalt in der damaligen Heimerziehung bei.
Aus dem Widerspruch zwischen pflegerischem Anspruch und der Wirklichkeit des Pflegealltags entwickeln PflegeschülerInnen und examinierte Pflegekräfte Strategien der Kälte. Sie lernen hinzunehmen, wogegen sie an
...alles anzeigengehen müssten, weil es dem widerspricht, was sie verwirklichen wollen. Thema des Buches sind das Scheitern des pflegerischen Anspruchs in der Praxis und die Strategien, die dabei helfen, auch im Scheitern an diesem Anspruch festzuhalten. Die erste Auflage der Studie erschien 2002 unter dem Titel "Berufsbildung zwischen Anspruch und Wirklichkeit" im Verlag Hans Huber.